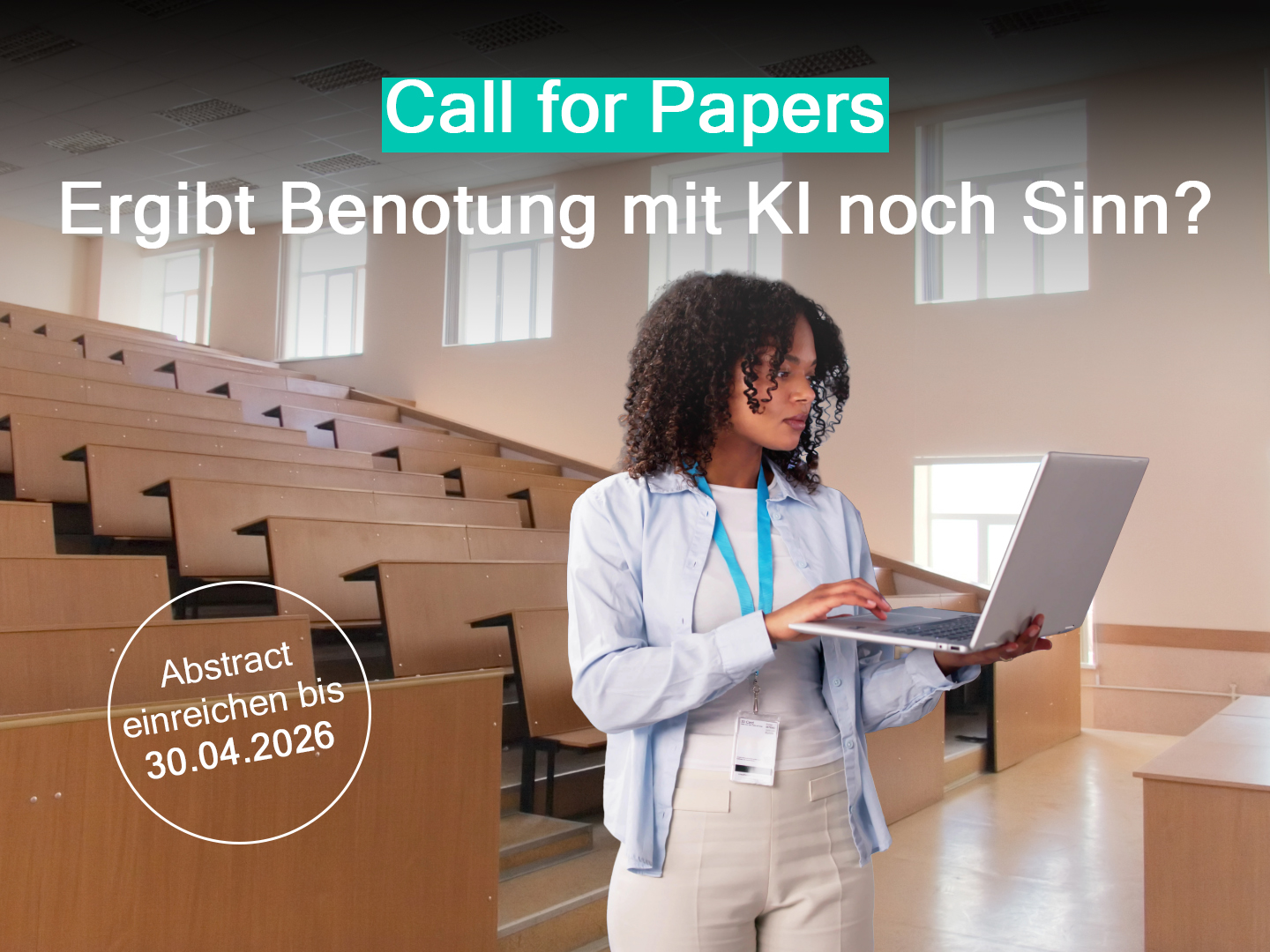Wie können Konflikte auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität gelöst werden? – Interview zum 17. Wissenschaftsforum Mobilität
Beim 17. Wissenschaftsforum Mobilität an der Universität Duisburg-Essen steht am 15. Mai 2025 ein Thema im Fokus: Wie können Konflikte auf dem Weg zu nachhaltiger Mobilität gelöst werden? Drei Forschende der FOM Hochschule bringen sich aktiv in den Track „Akzeptanz innovativer Verkehrslösungen“ ein.
Prof. Dr. Ann-Katrin Voit lehrt Wirtschaftspolitik am FOM Hochschulzentrum Essen und forscht an unserem KompetenzCentrum für angewandte Volkswirtschaftslehre (KCV). Ihr Vortrag trägt den Titel „Nachhaltige Mobilität im Spannungsfeld von Interessen und Akzeptanz – ein wirtschaftspolitischer Diskurs“. FOM Absolvent Philipp Noll M.Sc. ist Projektportfoliomanager, er promoviert derzeit berufsbegleitend zum Thema „Autonomous Driving – How New Technologies Influence Consumer Preferences and Affect Business Models for Private Car Sales“ und ist Research Fellow an unserem Institute of Mobility, Infrastructure, Logistics & Energy (mile). Prof. Dr. Roland Vogt leitet das mile und lehrt Strategisches Management am FOM Hochschulzentrum München. Ihr gemeinsamer Beitrag trägt den Titel „Die Rolle des Umweltbewusstseins in der Akzeptanz autonomer Fahrzeuge: Ein erweitertes UTAUT*-Modell“. Wir haben die drei vorab gefragt, wie sich wirklich etwas bewegen könnte.
Frau Professorin Voit, viele Menschen wollen nachhaltiger mobil sein – oft stehen jedoch wirtschaftliche oder auch politische Interessen im Weg. Was müsste sich ändern, damit neue Mobilitätslösungen wirklich bei allen ankommen?
Prof. Dr. Ann-Katrin Voit: Damit neue Mobilitätslösungen bei allen ankommen, braucht es einen grundlegenden Wandel – sowohl in der Infrastruktur als auch in der politischen Rahmensetzung. Der Umweltverbund, also Fuß-, Rad- und öffentlicher Verkehr, muss gezielt gestärkt werden: durch bessere und zuverlässigere Angebote, sichere Wege und barrierefreie Zugänge. Zugleich müssen wirtschaftliche Anreize neu gedacht werden. Solange fossile Mobilität subventioniert wird, haben nachhaltige Alternativen auf einem freien Markt kaum eine Chance. Eine faire CO₂-Bepreisung und gezielte Investitionen in emissionsfreie Lösungen sind zentrale Hebel. Entscheidend ist aber auch die soziale Dimension: Mobilität muss für alle zugänglich sein – unabhängig von Einkommen, Wohnort oder körperlichen Voraussetzungen. Nur wenn Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Teilhabe zusammengedacht werden, kann die Verkehrswende wirklich gelingen.
Herr Noll und Herr Professor Vogt, Sie beschäftigen sich mit der Frage, ob Umweltbewusstsein dabei hilft, autonome Fahrzeuge besser anzunehmen. Wie offen sind die Menschen Ihrer Meinung nach aktuell für solche Technologien – und was könnte helfen, Vorbehalte abzubauen?
Philipp Noll: Die bisherigen Ergebnisse meiner Untersuchung zeigen, dass Umweltbewusstsein die Akzeptanz autonomer Fahrzeuge eher indirekt beeinflusst: Umweltbewusstere Menschen entwickeln eine positivere Einstellung zu neuer Technologie, was ihre Nutzungsbereitschaft erhöht. Besonders wirken Umweltaspekte, wenn sie als Vorteile – wie etwa Nachhaltigkeitspotenziale autonomer Mobilität – wahrgenommen werden. Insgesamt ist die Offenheit gegenüber autonomen Fahrzeugen aber noch zurückhaltend, da viele Menschen Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder des Kontrollverlusts hegen. Transparenz und eine klare Kommunikation könnten hier hilfreich sein. Vor allem umweltbewusste Zielgruppen könnten autonome Shuttles in Innenstädten als Beitrag zum Klimaschutz eher akzeptieren.
Ob E-Auto, Bus und Bahn oder Fahrrad – es gibt viele Ideen für umweltfreundlichere Mobilität. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit nachhaltige Angebote im Alltag wirklich genutzt werden – und nicht nur auf dem Papier gut aussehen?
Prof. Dr. Roland Vogt: Damit nachhaltige Mobilität im Alltag ankommt, reicht es nicht, dass die Angebote – seien es alte oder neue – technisch gut sind. Sie kann nur funktionieren, wenn die politischen Rahmenbedingungen stimmen und Menschen neue Mobilitätsangebote überzeugt in ihren Alltag integrieren. Entscheidend ist, dass sie als echte Alternative erlebt werden. Das setzt Technologieoffenheit und passende politische Rahmenbedingungen voraus, damit Menschen aus verschiedenen Lösungen die wählen können, die zu ihrem Leben passen. Politik und Wirtschaft müssen die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, damit individuelle Entscheidungen für nachhaltige Optionen möglich und attraktiv werden. Mobilitätsentscheidungen werden auf Basis individueller Bedürfnisse, Erfahrungen und Werte getroffen, das zeigt sich insbesondere bei der Anbindung ländlicher Regionen an die Städte. Wenn neue Angebote verlässlich zugänglich sind und sinnvoll kommuniziert werden, kann dies zu einer Akzeptanz führen, die auf echter Überzeugung und erlebtem Mehrwert basiert. In Ballungsräumen könnte der berufliche Individualverkehr durch integrierte Mobilitätsangebote und intelligente Planung so gestaltet werden, dass er effizienter wird und allen Beteiligten Vorteile bringt. Technologieoffenheit heißt, innerhalb sinnvoller politischer Leitplanken die passende Lösung wählen zu können.
Beim Wissenschaftsforum Mobilität 2024 hat Professorin Voit bereits einen Vortrag gehalten. Ihr Beitrag mit dem Titel „Zwischen Effizienz und Verantwortung: Die Implementierung ethischer Prinzipien in der Mobilitätsbranche zur Harmonisierung von Ökonomie und Gesellschaft“ erscheint in Kürze im Tagungsband.
*UTAUT steht als Akronym für Unified Theory of Acceptance and Use of Technology.
Yasmin Lindner-Dehghan Manchadi M.A. | Referentin Forschungskommunikation der FOM Hochschule | 07.05.2025
Suche nach Beiträgen
Beitrag teilen
Gründerinnen aufgepasst: Bis zum 1. Februar 2026 für den Female Founders Award 2026 bewerben
Die FOM Hochschule unterstützt als Partnerin den AmCham Germany Female Founders Award. „Seit 2019 macht der renommierte Preis Gründerinnen zu internationalen Role Models und verschafft ihnen über das AmCham-Netzwerk große Sichtbarkeit ..."
WeiterlesenDie Macht der Note? Bewertungskulturen im Studium der Sozialen Arbeit & Sozialpädagogik – Call for Papers für Sammelband
Noten prägen das Studium. Sie setzen Lernanreize, strukturieren Übergänge und signalisieren Leistung nach außen. Doch in der Massenuniversität stellen sich Fragen nach Fairness, Sinn und Zweck von Bewertung. Verschärft wird dies durch generative KI ...
WeiterlesenWie Prozesse abgebildet und optimiert werden, damit Unternehmen Krisen besser standhalten können – Studierende in Forschung eingebunden
Viele Branchen sind abhängig von unvorhergesehenen Faktoren, auf die schnell reagiert werden muss, um handlungsfähig zu bleiben. Die Textilbranche beispielsweise ist abhängig von globalen Zusammenhängen: Lieferketten können durch Krisen gestört werden ...
Weiterlesen