Smarte Mobilität: Zukunftsforschung in der Automobilbranche - Fallstudie zum Smart

18.05.2017 – 2001 kam der Klein- und Stadtwagen Smart auf den europäischen Markt. Zusammen mit dem damaligen Leiter der Corporate Foresight der Daimler AG, Prof. Dr. Eckard Minx, hat Prof. Dr. Friederike Müller-Friemauth vom KCT KompetenzCentrum für Technologie- & Innovationsmanagement den insgesamt über 25 Jahre andauernden Foresight-Prozess dieser radikalen Innovation in einer aktuellen Veröffentlichung rekonstruiert und bewertet. Wie läuft ein komplexer Foresight-Prozess ab? In zwei Beiträgen stellt sie das Fallbeispiel vor und fasst zentrale Erkenntnisse zusammen.
Teil 2: Innovationsstrategische Lernkurven
Neben der Frage, wie aus organisationsinterner Zukunftsforschung (Corporate Foresight) eine radikale Innovationsidee entsteht, ist eine genauso wichtige Herausforderung, wie über viele Jahre ausgerechnet eine radikale und damit besonders kritikanfällige Idee die internen Kontroversen zu einem solchen Projekt überlebt. Wie führt eine Organisation radikale Innovationen zum Erfolg?
Zusätzlich zu diesem prinzipiellen Führungsaspekt kam im Fall Smart erschwerend hinzu, dass einige empirische Marktanalysen, was Produktaffinitäten und Konsumentenbedürfnisse betrifft, nicht gerade ermutigend ausfielen. Auch ist bekannt, dass der Smart als Mobilitätskonzept – also jenseits des Stadtwagens als solchem – um einige Jahre zu früh kam. Und die sogenannten „Innovators“ (die besonders innovationsaffine Erst-Zielgruppe) war nicht diejenige Käuferschaft an jungen, urbanen, gut gebildeten Gruppierungen, die man prognostiziert hatte.
Wie zahlreiche andere radikale Innovationsbeispiele belegen: Solche Hürden sind im Prozessverlauf radikaler Innovationen normal – bloß mindert das nicht den Gegenwind, den sie für solche Projekte intern bedeuten. Unsere Rekonstruktion des Smart-Beispiels förderte eine Vielzahl instruktiver Einsichten zutage, die sich in hinreichender analytischer Schärfe erst im Nachhinein formulieren lassen. Zwei Beispiele…
Es kam in keiner Phase zu einem direkten, gravierenden ‚Clash of Cultures’ zwischen rein betriebswirtschaftlicher Steuerungslogik und strategischer Langfristorientierung. Die Überzeugung der Führung ließ sich nie grundlegend empirisch irritieren (was im Vergleich zum Mindset der BWL bemerkenswert ist). Erklärbar erscheint das allein aus der grundlegenden unternehmerischen Entscheidung heraus, die eng mit der Identität des Konzerns verknüpft war: Man wollte Umweltsensitivität praktisch umsetzen („beweisen“), investierte eine Menge vorauseilenden Stolzes in diesen mutigen Antritt und traute sich zu, sich von ihr über die Jahre vertrauensvoll tragen zu lassen. Um es deutlich zu formulieren: Dieser – typische – Charakterzug von Zukunftsforschung ist geradezu Anti-BWL. Er repräsentiert jedoch gleichzeitig die Bedingung der Möglichkeit von Markterfolg von radikalen Innovationen, der allein über die Business School-Tradition des klassischen Innovationsmanagements nicht zu erklären ist.
Weiterhin erwies sich eine der zentralen Stärken dieser Corporate Foresight darin, die unternehmerische Perspektive – systematisch professionalisiert – auf gesellschaftliche (politische, kulturelle, wertabhängige) Veränderungen zu richten. Klassische Innovationswerkzeuge laufen häufig Gefahr, den Blick zu verengen auf die Fragen: Welche Idee? Woher die richtige Inspiration nehmen? Auch in aktuellen Innovationsprojekten größerer Unternehmen, die unter dem Label ‚Zukunftsforschung’ laufen, ist durchaus nicht immer auch Zukunftsforschung ‚drin’ – denn, zumindest am Fall Smart bemessen, gründete der letztendliche Erfolg dieses Experiments gerade nicht auf einer ‚genialen’ Anfangsidee, die man durch eine Inspiration durch Künstler*innen, Reisen zu vermeintlichen Benchmarks oder etwas ‚Ganz-Anderes’ gewonnen hätte, sondern – man ist versucht zu formulieren: ganz im Gegenteil – durch eine tiefgehende, detailreiche Analyse einer Sachfrage, die konsequent auf ihren gesellschaftlichen Zukunftskontext; auf ihre Relevanz, etwa für Städte oder Berufsreisende, bezogen wurde.
Als Autoren erscheint uns die Beschäftigung mit konkreten Foresight-„Fällen“ lohnenswert. Sie gewährt andere, neue Blickrichtungen darauf, wie Unternehmen „gut“ innovieren – und das „Gute“ daran hat häufig mit professionellen Prozessarchitekturen, „richtig Rechnen“ oder treffsicheren Prognosen nur wenig zu tun.
Prof. Dr. Friederike Müller-Friemauth, KCT KompetenzCentrum für Technologie- & Innovationsmanagement
Der erste Beitrag zur Ideenentwicklung dieses Projektes erschien am 11. Mai 2017.

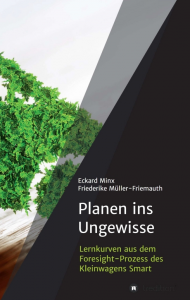 Der Essay Planen insUngewisse. Lernkurven aus dem Foresight-Prozess des Kleinwagens Smart ist gerade bei Tredition erschienen.
Der Essay Planen insUngewisse. Lernkurven aus dem Foresight-Prozess des Kleinwagens Smart ist gerade bei Tredition erschienen.
Suche nach Beiträgen
Beitrag teilen
Pflegeausbildung stärken: Projekt „PfAu“ erfolgreich abgeschlossen – mit klaren Empfehlungen
Wie können Ausbildungsabbrüche in der Pflege verhindert und Kompetenzen gezielt gefördert werden? – Aufbauend auf den Ergebnissen aus dem Projekt „Erfolgreich für die Pflege qualifizieren“ hat das Folgeprojekt ...
WeiterlesenZehn Jahre Digital Health im Fokus – Ein Interview zur Erfolgsgeschichte der Tagung „eHealth & Society“
Zehn Jahre „eHealth & Society“ (eHS) – ein Jubiläum, das nicht nur für fachliche Exzellenz steht, sondern auch für beständiges Engagement, Teamgeist und Innovationskraft. Hinter der erfolgreichen Transfertagung steht ein engagiertes Tagungskomitee, das mit Weitblick und Leidenschaft Jahr für Jahr den Austausch zwischen Gesundheitswissenschaften und -praxis ermöglicht.
WeiterlesenInternationalisierung der Forschung an der FOM: Kooperation mit der TU Sofia und der FDIBA
Die FOM Hochschule verfolgt eine konsequente Internationalisierungsstrategie in der Forschung, um wissenschaftlichen Austausch, transnationale Netzwerke und anwendungsorientierte Erkenntnisse zu stärken. Ein zentrales Element dieser Strategie ist die Zusammenarbeit mit internationalen...
Weiterlesen

