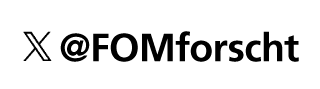Research Fellows im Porträt: „Dass ich in der Medizin lande, hätte ich zu Studienzeiten nie gedacht“

08.09.2017 – 50 Jahre alt, Chefsekretärin am Münchner Klinikum Großhadern, verheiratet, eine studierende Tochter: Auf den ersten Blick lässt nichts darauf schließen, dass Andrea Lakasz parallel zu Job und Familie als Research Fellow am ifgs Institut für Gesundheit & Soziales der FOM Hochschule aktiv ist. Wie es dazu kam und welche Schwerpunkte sie bei ihrer wissenschaftlichen Arbeit setzt, verrät die gebürtige Ungarin im Interview.
Wie kam der Kontakt zum ifgs zustande?
Andrea Lakasz: Ich habe an der FOM Hochschule in München berufsbegleitend den Bachelor-Studiengang Gesundheits- und Sozialmanagement absolviert. In den Vorlesungen habe ich Prof. Dr. habil. Manfred Cassens kennengelernt, einen der beiden Direktoren des ifgs. Nach meinem Abschluss sind wir in Kontakt geblieben und haben uns über mögliche Forschungsthemen unterhalten. Als gebürtige Ungarin habe ich Einblicke in ein anderes als das deutsche Gesundheitssystem – daraus ist die Idee entstanden, etwas mit Schwerpunkt Ungarn zu machen. Prof. Dr. Cassens ist dann auf eine entsprechende Ausschreibung beim BMBF Bundesministerium für Bildung und Forschung gestoßen, und im April 2017 ist schließlich der Startschuss für das Projekt Arteria Danubia gefallen.
Bei dem Projekt geht es – verkürzt ausgedrückt – um die Implementierung von Modellgesundheitsregionen im Bereich Ober- und Unterlauf der Donau. Wo liegen dabei Ihre Aufgaben als Research Fellow?
Andrea Lakasz: Ich kümmere mich in erster Linie um die Kontakte und den Netzwerkaufbau. Einer unserer Projektpartner ist beispielsweise die Eötvös Loránd University in Budapest. Ich stehe in engem, auch persönlichen Austausch mit unseren Ansprechpersonen dort und werde auch an dem ersten Arteria-Danubia-Workshop teilnehmen, der im Oktober 2017 ansteht.
Hatten Sie selbst auch noch Kontakte zur Eötvös?
Andrea Lakasz: Zwar habe ich an der Universität studiert, aber im Bereich Philologie. Dass ich mal in der Medizin lande, hätte ich zu Studienzeiten nie gedacht…
Wie kam es denn dazu?
Andrea Lakasz: Das war ehrlich gesagt Zufall. Nach meinem Studienabschluss als Diplom-Dolmetscherin war ich lange im Bereich internationale Beziehungen bei einem Regierungsamt in Budapest tätig. Mein Mann arbeitete bereits damals an der Ludwig-Maximilians-Universität München. 2000 bin ich nach Deutschland umgezogen und konnte über meinen Mann beruflich Fuß am Klinikum der LMU München fassen. Dort arbeite ich jetzt seit 2003, wirkte in mehreren neuen Bereichen mit, habe mich mit Personal, Controlling und Qualitätsmanagement befasst. Deshalb auch das berufsbegleitende Studium an der FOM Hochschule. Gerade im Gesundheitswesen bewegt sich so viel, dass lebenslanges Lernen einfach Pflicht ist. Sonst wird es schwierig, mit den Entwicklungen Schritt zu halten.
Verlaufen die Veränderungen im ungarischen Gesundheitssystem ähnlich rasant?
Andrea Lakasz: Ungarns Gesundheitswesen hat sich nach der Wende in eine vollkommen andere Richtung entwickelt. Aktuell ist es ein out-of- pocket-System mit einem Mischmasch von Ansätzen, die absolut unübersehbar sind. Die Gesundheit der Bevölkerung steht dabei allerdings nicht im Vordergrund. Das macht sich vor allem auf dem Land bemerkbar, wo die ärztliche Versorgung nicht überall gewährleistet ist. Eine Freundin von mir arbeitet in der Region Győr als Ärztin und ist glücklich, wenn sie pro Tag nur 85 Patientinnen und Patienten hat. In der Regel sind es aber um die 130. Mit Arteria Danubia könnte man dort viel bewegen. Deshalb bietet sich Győr auch als Pilotregion an.
Wie könnte das in der Praxis aussehen?
Andrea Lakasz: Im Mittelpunkt des Projektes steht die Frage, ob sich das Konzept der sogenannten Gesundheitsregionen auf Ungarn und Bulgarien übertragen lässt – mit der Zielsetzung, gegebenenfalls offene Forschungsfragen zu identifizieren und auf längere Sicht die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung zu verbessern. Konkret heißt das, dass wir in ausgewählten Regionen diskutieren, ob Netzwerke lokaler Gesundheitsakteure geschaffen und dadurch neue Projekte angestoßen werden können. Dadurch soll langfristig u.a. gewährleistet werden, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der jeweiligen Region kompetente Anlaufstellen für Gesundheitsfragen haben. Wie das in der Praxis funktioniert, zeigt das Beispiel der Gesundheitsregion Bamberg.
Gibt es – neben Arteria Danubia – weitere Projekte, die Sie als Research Fellow begleiten?
Andreas Lakasz: Mit Prof. Dr. Thomas Breisach habe ich eine Umfrage in der Klinik für Strahlentherapie der LMU München durchgeführt. Dabei ging es um die Zufriedenheit von Patientinnen und Patienten– und zwar mit Blick auf den Empfangsbereich. Bei vergangenen Umfragen im Rahmen des QM hat die Klinik hier schlecht abgeschnitten. Das lag u.a. daran, dass das Gebäude von der Architektur her sehr nachteilig empfunden wird und die Patientinnen und Patienten gleichzeitig sehr angeschlagen sind. Damit wahrscheinlich verbundene negative Emotionen entluden sich nicht selten bei den Kolleginnen am Empfang.
Im Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses wurden daher verschiedene Maßnahmen ergriffen, um den Patientinnen und Patienten ein angenehmeres Umfeld zu bieten. Der Prozess setzte bei baulichen Veränderungen an und reicht mittlerweile bis zur Einstellung von neuem Personal. Ob durch das eingeleitete KVP-Paket die avisierten Verbesserungen eingetreten sind, haben wir im Rahmen der Befragung 2016 überprüft. Zu den Ergebnissen bereiten wir aktuell eine Publikation vor.
Suche nach Beiträgen
Beitrag teilen
Call for Papers: Neues Arbeiten in Projekten – Teamarbeit neu interpretiert
Wie wird sich das Arbeiten in Projektteams weiterentwickeln – insbesondere in einer Arbeitswelt, die zunehmend von neuen Tools mit Künstlicher Intelligenz (KI) geprägt ist? Wie kann Teamarbeit gestaltet werden? Diese und weitere Fragen sollen bei der Fachtagung „PVM 2024“ mit dem Schwerpunkt ...
WeiterlesenStudienergebnisse zu kultureller Kompetenz von deutschem Gesundheitspersonal veröffentlicht
Die soziokulturelle Vielfalt im deutschen Gesundheitssystem spiegelt sich zunehmend in multikulturellen Teams und der Vielfalt der Patienten wider. Um eine erfolgreiche Zusammenarbeit in einem multikulturellen Umfeld und eine effektive Versorgung vielfältiger Patientinnen und Patienten zu gewährleisten ...
WeiterlesenDie Forschungspreise 2024 der FOM gingen an Prof. Dr. Mira Fauth-Bühler und Prof. Dr. Thomas Mühlbradt
Auch in diesem Jahr verlieh die FOM Hochschule Preise für besondere Verdienste und Engagement in der Forschung. Prof. Dr. Thomas Heupel, Prorektor Forschung, und Vize-Kanzler Dipl.-Ing. (FH) Christoph Hohoff fassten bei der Verleihung den aktuellen Stand des Forschungsgeschehens an unserer Hochschule zusammen und bedankten sich bei den Lehrenden, die sich in erheblichem Umfang für neue wissenschaftliche Erkenntnisse stark machten und engagierten.
Weiterlesen